Shir B. absolvierte 2020 das Masterprogramm „Konflikttransformation und soziale Gerechtigkeit“ in Belfast. Ihre Masterarbeit schrieb sie über das palästinensisch-israelische Dialogseminar für Frauen*, welches sie koordiniert. Im Gespräch mit Katharina Ochsendorf erzählte sie, worum es in ihrer Masterarbeit geht und was sie für ihre Arbeit als Koordinatorin mitnimmt.
K.O.: Warum wolltest du deine Arbeit über das Projekt schreiben?
S.B.: Es gibt viele Aspekte des Projekts, die es für mich außergewöhnlich machen, die ich aber nie in Worte gefasst habe; insbesondere hinsichtlich des Potentials, das unser Konzept für Dialogräume generell bietet. Meine Hauptmotivation war erstmal, meine Gedanken und mein Wissen besser zu artikulieren. Anfangs hatte ich verschiedene Ideen hinsichtlich des Fokus der Arbeit, zum Beispiel wollte ich über Normalisierung und die Frage der (Un-)Möglichkeit von Dialogprozessen ohne Normalisierung schreiben, aber am Ende konzentrierte ich mich auf die Frage, inwieweit es den Dialogprozess beeinflusst, wenn keine Männer* dabei sind und was wir daraus sowohl für reine Frauen*projekte als auch für solche, in denen alle Geschlechter vertreten sind, lernen können.
K.O.: Was waren die Ergebnisse deiner Untersuchung?
S.B.: Aus den Interviews mit ehemaligen Teilnehmenden und Mitarbeitenden ergab sich vor allem, dass die Abwesenheit von Männern* den Teilnehmenden erlaubt, in einen tiefen Dialog einzusteigen. Im Dialog ging es nicht darum, einander wie in einem Wettstreit Argumente an den Kopf zu werfen, sondern im Kern war es immer ein wechselseitiges Zuhören und ein Teilen von Erfahrungen, das zu einer Analyse der Konfliktrealität in ihrer Komplexität führte. Das bedeutete auch, sich selbst Raum zu geben, was sehr wichtig ist. Für die israelische Gruppe erlaubt dies beispielsweise, ihre eigenen Erfahrungen mitzuteilen und so über ein Gefühl von Schuld hinauszugehen. Nicht, dass alle das geschafft hätten; manche sind in Schuldgefühlen steckengeblieben, andere zu Wut und Ärger übergegangen (…). Aber gerade nach dem Seminar 2019 konnte ich feststellen, wie die Erfahrung selbst bei den Teilnehmenden, die nicht viel in Kontakt geblieben sind, weiterarbeitet. Eine Teilnehmerin schickte mir zum Beispiel sieben Monate nach dem Seminar eine Nachricht in der stand, wie unheimlich bedeutsam die Erfahrung für sie war und wie viel sie daraus gelernt hat. Aber sowas passiert immer wieder: Vor kurzem erhielt ich eine E-Mail von einer Teilnehmenden, die vor vier Jahren am Seminar teilnahm. Sie war in einer Siedlung aufgewachsen und kam mit einer stark zionistischen Überzeugung zum Seminar. Vier Jahre später schreibt sie mir, wie viel das Seminar für sie verändert hat.
Im Seminar begegnen sich nicht „nur“ Menschen zweier Nationalitäten, die miteinander in Konflikt stehen; sondern auch Menschen, die miteinander in einen sehr tiefen Dialogprozess einsteigen. Das Seminar vermittelt den Teilnehmenden eine sehr außergewöhnliche Art der Kommunikation miteinander. Dabei geht es nicht „bloß“ um den Konflikt. Das bedeutet einerseits, zum Beispiel über Fragen von Schuld hinauszugehen, aber gleichzeitig auch, ehrlich über die Situation miteinander zu reden. Ich meine, einen Blick über den Tellerrand zu werfen, aber nicht wie der Kontaktansatz suggeriert, nach dem Motto „bekämpft Vorurteile, wir lieben doch alle Hummus“, sondern dass wir sehen lernen, dass unsere Identitäten komplexer sind, dass wir „mehr“ sind als Israel*innen und Palästinenser*innen. Eine palästinensische Teilnehmerin drückte das in einer Metapher aus: es ging seinerzeit in der Gruppendiskussion um Diskriminierung und die Tatsache, dass Mitglieder der LGBTTIQ*-Gemeinde sowohl in Israel als auch in Palästina Diskriminierung erfahren. Da sagte sie: ‚Wir haben beide Angst, nachts durch eine dunkle Gasse zu laufen, aber es besteht eine große Chance, dass deine Gasse nicht so dunkel ist wie meine‘. Eine sehr gute Metapher.
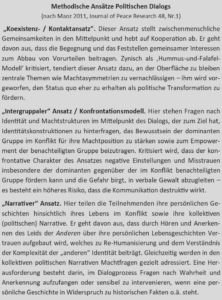
K.O.: Gab es auch Ergebnisse, die dich überrascht haben?
S.B.: Ich weiß nicht, ob überrascht das richtige Wort ist, aber es war so, dass ich mit bestimmten Ideen zu den Interviews kam und dann einige Themen doch gar nicht oder nur am Rande vorkamen. (…) Ich dachte zum Beispiel, es würde sehr viel um Definitionen von Weiblichkeit und Geschlecht gehen und dem war nicht so. Stattdessen sprachen die Frauen* vor allem über zwei interessante Aspekte. Einmal wurde klar, dass die sogenannte „Frauen-und-Frieden-Hypothese“ irgendwie Teil von uns allen ist. Das heißt, wir denken tendenziell, dass Frauen* irgendwie grundsätzlich freundlicher wären, eher zu Kompromissen tendieren etc., Charakteristiken, die Frauen oft zugeschrieben werden. Dies zeigte sich in Aussagen wie „ja, Frauen* hören einfach besser zu“ oder „es war so ein sicherer Raum, weil Frauen* weniger verurteilend sind“. Auf der anderen Seite bezogen sich viele der Interviewpartnerinnen sehr häufig auf die Abwesenheit von Männern*: Wenn sie von der Atmosphäre im Seminar und den Grenzen und Möglichkeiten sprachen, sagten sie oft Dinge wie „wenn Männer* dabei gewesen wären, hätten wir dieses oder jenes nicht tun können“. (…) Daher habe ich beide Definitionen des Dialograums genutzt, einerseits die Abwesenheit von Männern* und andererseits das Setting als exklusiv für Frauen*. Beide sind wichtig, aber für mich persönlich ist erstere bedeutsamer, auch, weil ich der „Frauen-und-Frieden-Hypothese“ sehr kritisch gegenüberstehe (…).
Das Fazit meiner Arbeit ist: Es geht nicht darum, dass Frauen* aufgrund ihres Geschlechts „naturgegebene“ oder essentielle Charaktereigenschaften besäßen, die Dialog einfacher machen würden. Es sind vielmehr ihre Lebensbedingungen, also Kontextfaktoren wie Muster politischer Gewalt, kollektive Identitäten, soziale Klasse und geschlechtsspezifische Diskriminierungsstrukturen, die dazu führen, dass der Dialog zwischen ihnen von der Abwesenheit von Männern* profitiert. Beispiele hierfür sind die Abwesenheit von Restriktionen, die palästinensische Frauen* erleben, wenn sie in geschlechtergemischten Räumen agieren, die Tatsache, dass die meisten israelischen Frauen* in der Armee nicht im aktiven Kampfeinsatz sind, oder die Möglichkeit, in einem sicheren Raum über Themen wie sexualisierte Gewalt zu sprechen.
Ein anderer Aspekt, der mir im Laufe der Arbeit bewusst wurde, ist, dass es auch um Herausforderungen des intergruppalen Dialogansatzes im Allgemeinen geht. (…) Auf der „Metaebene“ war es eine spannende Erkenntnis, dass unsere Arbeit in bestimmten Hinsichten das gesamte Feld der Dialogseminararbeit voranbringt und nicht nur etwas über Dialogräume speziell für Frauen* aussagt, sondern aufzeigt, wie Dialog generell aussehen kann.
K.O.: Also lassen sich deine Forschungsergebnisse übertragen?
S.B.: Ich bin überzeugt, dass wir von dem, was im Frauen*seminar passiert, eine Menge für gemischtgeschlechtliche Dialogprojekte lernen können. Denn was dort passiert, ist etwas Universelles. (…) Ich habe einerseits eine bestimmte Position in der Welt und diese ist wichtig, weil sie meine Realität formt. Andererseits habe ich auch Werte und Vorstellungen davon, wie die Dinge sein sollten und das kann mich mit Anderen verbinden. Beispielsweise bin ich Schwarz und lesbisch, aber nicht all meine Interessen und Meinungen werden sich mit denen anderer Personen decken, die Schwarz und lesbisch sind. Ich kann viel mehr sein als das, ohne, dass ich ignoriere, dass meine Position in der Welt vielfältige Implikationen hat. – Das Stichwort hier sind Fragen nach Identitätspolitiken. (…) Das Schwierige ist, anzuerkennen, dass wir von unterschiedlichen Positionen aus sprechen (zum Beispiel von unterschiedlichen Machtpositionen aus) und wir dennoch gemeinsame Vorstellungen und Ideen haben können.
K.O.: Was hast du aus deiner Abschlussarbeit für das Projekt Ferien vom Krieg mitgenommen?
S.B.: Ich werde das Seminar jetzt durch andere „Brillen“ sehen als bisher. Ich habe auch auf konzeptioneller Ebene einige Ideen, das Seminar weiter zu verbessern (…). Nicht zuletzt hat mir die Abschlussarbeit Lust gemacht, auch mehr Seminare zu moderieren, die für alle Geschlechter offen sind.
