Noa M.* (29) lebt in Haifa in Israel. Dort studiert sie Philosophie und Kognitionswissenschaft. Hauptsächlich jedoch arbeitet sie, teils ehrenamtlich, in sozialen, gemeinschaftlichen Projekten und Initiativen. Im Interview spricht sie über ihre Familiengeschichte, die Situation von äthiopischen Juden und Jüdinnen, ihren Aktivismus und über ihre Erfahrungen im Seminar.
TP: Im Seminar hast du deine Familiengeschichte erzählt – würdest du sie hier nochmal erzählen?
NM: (…) Meine Familie kam aus Äthiopien, als ich etwas über ein Jahr alt war. Meine Eltern stammen aus unterschiedlichen Teilen Äthiopiens. Sie lernten sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bei einer Lehrer*innenausbildung in Äthiopien kennen. (…) Dann fiel das kommunistische Regime und sie beschlossen während des Kriegs, das Land zu verlassen. Meine Mutter ist jüdischer Abstammung, also kamen wir nach Israel; sie hat hier einige Verwandte. Wir kamen zuerst in ein Aufnahmezentrum für Einwanderer*innen. Denn wenn man Jude oder Jüdin ist, hat man für ein paar Jahre Anrecht auf staatliche Fürsorge, eine Wohnung, Hebräischunterricht und so weiter. (…) Ich bin in Israel in verschiedenen Städten aufgewachsen. Nachdem er lange darum gekämpft hatte, weil Israel seine Ausbildung nicht anerkannte, konnte mein Vater als Lehrer arbeiten. Meine Mutter gab auf und wurde Sekretärin. Aber innerhalb der äthiopischen Gemeinschaft in Israel sind das sehr gute Jobs. Wir waren sozusagen die Könige des Ghettos. Ich war als „die Lehrerstochter“ bekannt, denn es gab nur einen einzigen äthiopischen Lehrer, den wir in ganz Israel kannten. (…)
Wir kamen zuerst in ein Aufnahmezentrum für Einwanderer*innen, denn wenn man jüdisch ist, hat man für ein paar Jahre Anrecht auf staatliche Fürsorge, eine Wohnung, Hebräisch Unterricht und so weiter. Danach bist man auf sich allein gestellt. (…)
TP: Kannst du etwas mehr über die Situation der äthiopischen Juden und Jüdinnen in Israel im Allgemeinen sagen?
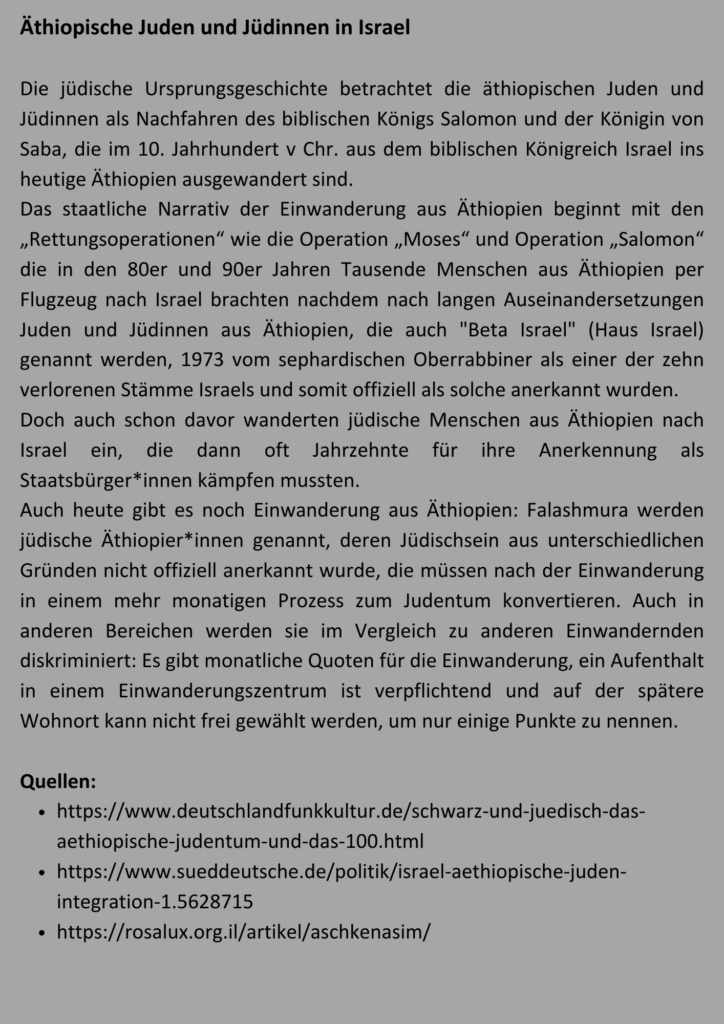
NM: Ihre Situation ist sehr kompliziert. Israel besteht aus so vielen Kulturen. Aber die größten Gruppen sind die Mizrachim, Juden und Jüdinnen aus nordafrikanischen und arabischen Ländern und Ashkenazim, die normalerweise aus Mitteleuropa und teils aus dem Osten Europas stammen, aber bei Letzteren gibt es eine Diskussion darüber, ob sie als Aschkenazim gelten oder nicht. Die Hegemonie liegt eindeutig bei den weißen Europäer*innen, auch wenn sie nicht mehr in der Mehrheit sind (…) Äthiopier*innen machen weniger als 2 % der israelischen Bevölkerung aus. Sie sind mit vielen der bereits bekannten Formen von Unterdrückung konfrontiert, denen andere nicht-europäische Juden in Israel ausgesetzt waren und sind, aber als kleinste Gruppe der Nicht-Weißen gehen sie in diesem System nahezu unter. Sie sind mit allem konfrontiert, was die Mizrachim in den 50er, 60er und 70er Jahren erlebt haben, obwohl die Äthiopier*innen erst in den 80er Jahren eingewandert sind. Bis vor kurzem galten sie als unterwürfige und ruhige Menschen, die nicht für ihre Rechte kämpfen (…). Aber es wurden mehrere Verbrechen gegen unsere Community durch die Polizei oder Justiz verübt und die neue Generation, die hier geboren wurde, hat keine Lust mehr ihren Mund zu halten – so wie man es uns in unserer Community beigebracht hat. In den letzten 5–7 Jahren, ich glaube, es begann 2014/15, gab es viele Demonstrationen, fast Krawalle, weil unser Schmerz verschwiegen und unter den Teppich gekehrt wird. Wir sind mit viel Leid konfrontiert (…). Außerdem wurde unser Judentum lange Zeit nicht als richtiges Judentum anerkannt, weil es alt ist und einer anderen Strömung angehört. Unsere Ausbildung wurde nicht anerkannt. Kurzum, wir, also weniger als 2 % der Gesamtbevölkerung, wurden allein gelassen, um in unseren kleinen Ghettos zu versauern und zu sterben. Auch wenn meine Generation und die jüngeren Generationen protestiert haben, hat sich nicht viel geändert.
Doch immerhin gibt es nun mehr Anerkennung dafür, dass für Äthiopier*innen andere Regeln gelten (siehe Infobox), als für alle anderen in Israel und dass sie nicht die gleichen Rechte haben oder bekommen. Zudem, leben weiterhin viele in Armut. Von 2 % der Bevölkerung sind nur etwa 0,00-irgendwas Prozent Akademiker*innen. Ich glaube, man kann die Zahl der Promovierten an einer Hand abzählen. (…) Israel nutzt Äthiopier*innen manchmal als Aushängeschild, um zu zeigen, wie liberal und multikulturell es ist. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir das Schlusslicht der Gesellschaft sind, sobald man uns nicht mehr als multikulturelles Symbol präsentieren kann.
TP: (…) Lass uns ein wenig über das Seminar sprechen. Was war deine Motivation daran teilzunehmen?
NM: (…) In meinem Herzen und meinem Kopf bin ich bei allen Kämpfen gegen soziale Ungerechtigkeit dabei. Aber immer, wenn es darum geht, Betroffene von Ungerechtigkeiten persönlich zu treffen, ihre Geschichte zu hören, sie kennenzulernen, ein Gesicht zu einem Namen zu haben, werde ich ein bisschen zu emotional (…). Ich würde einfach anfangen zu weinen, und es ergibt keinen Sinn, auf eine Demo zu gehen, um dann nur zu weinen. Deshalb habe ich mich bisher immer zu verletzlich gefühlt, um mich an direkten politischen Aktionen zu beteiligen. Mit dem Seminar wollte ich mich selbst herausfordern. (…) Das Seminar hilft mir, Mut zu fassen motiviert mich – nicht unbedingt, radikaler zu handeln, aber radikaler darüber nachzudenken, wie man Dinge noch tiefer verändern kann. (…)
TP: Hast du während des Seminars etwas erlebt, von dem du nicht gedacht hättest, dass es passieren würde?
NM: (lacht) Tatsächlich, ja. (…) Als Aktivist*in, sehe ich selbst in diesen Kreisen wenig Diversität, weil es manchmal wirklich ein Privileg ist, Aktivist*in zu sein (…). Bei diesem Privileg handelt es sich um einen schmalen Grat: Du musst so wenig privilegiert sein, dass auch Du von der Ungerechtigkeit betroffen bist, aber darfst auch nicht zu unterprivilegiert sein, weil dann kannst Du Dich nicht aktivistisch beteiligen, weil Du zu stark damit beschäftigt bist zu überleben. Dieser schmale Grat sorgt dafür, dass die unterdrückten Gruppen selbst in diesen Kämpfen oft kaum vertreten sind. Ich weiß nicht, ob das in den vergangenen Jahren so war, aber ich bin sehr froh über die Vielfalt der Teilnehmer*innen, vor allem in der jüdischen Gruppe. (…) Jede einzelne Teilnehmende hier (…) sogar die Jüngeren, die 18-, 20-Jährigen, sind so mitfühlende und fürsorgliche, kluge und erstaunliche Frauen. Ich bewundere jede einzelne von ihnen.
TP: Das freut mich. (…) Kannst du etwas mehr zu dir als Aktivist*in sagen und über den Workshop, den du geplant hattest und der dann nicht stattfinden konnte?
NM: Also, ich und eine andere Teilnehmer*in hatten vor, über Aktivismus und Macht zu sprechen. (…) In all unseren Gruppendiskussionen tanzten wir um das Wort „Macht“ regelrecht herum, wir nannten es Möglichkeit, Privileg, Fähigkeit, wir sagten alles außer Macht. (…) Und ich denke, das ist eine linksliberale, antifaschistische Denke, gut gemeint, die aber in gewisser Weise – ich will nicht sagen traumatisiert davon ist – aber Angst vor Macht hat, oder davor, Macht inne zu haben. Sababa [Okay, cool] – du willst deine Macht nicht missbrauchen, aber deine Macht zu ignorieren, ist für keine Auseinandersetzung gut!
Denn einige der jüdischen Teilnehmenden, aber auch einige der Palästinenser*innen, sind sehr privilegiert – und HABEN Macht! Und wir können sie nutzen und anerkennen. (…) Ich und die andere Teilnehmende sind [in Bezug auf unseren Aktivismus] das genaue Gegenteil der anderen. Ich schreibe Artikel; philosophische, moralische Essays und ich baue mit Freund*innen eine Organisation für Schwarze Kunst, Philosophie und Kultur in Israel auf, wo wir Schwarze, feministische Artikel übersetzen oder selbst welche schreiben, die auf unseren Erfahrungen in Israel basieren. (…) Wir machen Zeitschriften, Galeriegespräche, kuratieren Ausstellungen; wir machen diese Art von kognitivem oder eher akademischem, kulturellem Aktivismus. Und die andere Teilnehmer*in hat einfach alle ihre Freund*innen mitgenommen und ist in die Berge von Hebron gezogen, um den Palästinenser*innen bei allem zu helfen, was sie brauchen. Sei es, dass sie ihr Land oder ihre Felder bewachen oder dass sie jemanden haben, der dokumentiert, wenn die Soldat*innen angreifen; direkter, politischer Aktivismus. Das ist das, was sie gut kann. (…) Ich wollte einen Workshop machen, (…) in dem es darum geht, deine Macht zu kartografieren: deine Fähigkeiten, alle Leute und Organisationen, die du kennst und die dich unterstützen würden; bei z.B. Fundraising, Grafikdesign etc. (…) Und wenn man dann in den Raum schaut, auch wenn nur fünf oder zehn andere Frauen da sind, merkt man, dass man so viele Ressourcen hat (…) und dass man es zwar nicht alleine, aber zusammen schaffen kann. Macht ist nichts, wovor man Angst haben sollte. (…)
TP: Und jetzt hast du vor, den Workshop bei einem Nachfolgetreffen anzubieten?

NM: Wahrscheinlich. Wir haben einige Folgeveranstaltungen zu diesem Seminar geplant. Ich denke, das ist ein Muss. Wir können das, was wir aufgebaut haben, nicht einfach so stehen lassen und dann sagen „Tschüss – das war´s!“. Wir haben Macht, wir haben Privilegien, wir haben all diese Emotionen, die in uns brodeln, wir müssen sie irgendwo hinlenken, sonst explodieren wir. Ich würde gerne dabei helfen etwas aufzubauen.(…)
TP: Du hast von persönlichen Gesprächen außerhalb der Gruppensitzungen erzählt. Gab es einen besonderen Moment in diesen Gesprächen, den du hervorheben möchtest?
NM: (…) Ich hatte einen [besonderen Moment] und zwar mit der Teilnehmer*in aus Gaza. Sie ist ein Sonnenschein. Es ist seltsam, wie positiv sie ist, sie ist erstaunlich. (…) Ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben, aber danach, nach einer harten Sitzung, fühlte ich mich verdammt viel besser, und ich erinnere mich, wie sie eine jüdische Freund*in umarmte und ihr sagte, dass sie sehr mutig sei, weil sie etwas erzählt hatte, und ich dachte: „Meinst du das ernst? Du lebst in Gaza. Wie können wir mutig sein? Wer bist du?“.
Sie war so inspirierend, sie war elektrisierend. Das war einer der Momente, in denen ich dachte, wenn ihr etwas zustößt, werde ich persönlich Tel Aviv in die Luft jagen. Rührt sie nicht an! (…) Ich weiß, dass sie und einige andere Palästinenser*innen, die ich hier getroffen habe, in einem anderen Leben meine besten Freund*innen hätten sein können – sie sind so nett, so cool, so großartig, ich wünschte, sie wären meine besten Freund*innen. Ich arbeite für eine Zukunft, in der unsere Enkel*innen beste Freund*innen sein werden, weil ihre Großmütter so cool sind. Aber ich weiß, dass wir im Moment nicht befreundet sein können. Ich verstehe das.
